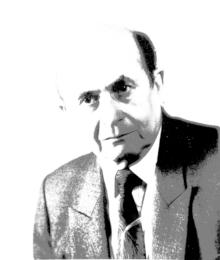Rudolf-Wildenmann-Nachwuchspreis 2024
für empirische Wahlforschung der Forschungsgruppe Wahlen e.V.
„Changing affective alignments between parties and voters“
(Zusammenfassung des Beitrags durch die Autoren)
Populistische Parteien haben besonders im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche Wahlerfolge erzielt. Einst ein Randphänomen zählen sie heute fest zu den Kräften, die in den Parlamenten westlicher Demokratien vertreten sind – selbst in Ländern wie Spanien und Deutschland, welche lange als „immun“ gegen den „populistischen Zeitgeist“ galten. Sowohl in den Sozialwissenschaften als auch unter politischen Beobachter:innen hat diese Entwicklung die Frage aufkommen lassen, was die Anziehungskraft populistischer Parteien ausmacht. Ein Erklärungsansatz hält den Populismus für emotionaler im Vergleich zu seinen politischen Mitbewerbern: Populist:innen versuchen insbesondere die Emotionen der Bürger:innen zu bedienen. Diese würden dann stärker affektgetrieben wählen als in der Vergangenheit.Unser Artikel untersucht diese Erwartung für den deutschen Fall. Wir verwenden dazu einen Datensatz, der durch die Forschungsgruppe Wahlen zur Verfügung gestellt wurde und deren Politbarometer Umfragen über mehrere Jahrzehnte hinweg zusammenfasst und harmonisiert. Dies erlaubt uns eine Analyse des Verhaltens der deutschen Wählerschaft über 44 Jahre (1977-2020) basierend auf 625 repräsentativen Umfragen mit über 375.000 Befragten.Wir finden empirische Belege für die Erwartung, dass Wählen in Deutschland emotionaler geworden ist als früher – allerdings mit einer wichtigen Qualifikation. Zwar treffen die Bürger:innen ihre Wahlentscheidung zu Beginn des 21. Jahrhunderts stärker affektgetrieben als vor der Jahrtausendwende, aber dies ist kein vollständig neues Phänomen. Die Wahl war ebenfalls zu Beginn der Zeitreihe in ähnlichem Maße an affektive Muster gebunden. Im Gegensatz zu heute war der Affekt der Wähler:innen damals allerdings eher durch soziostrukturelle Merkmale definiert.Genauer gesagt finden wir unterschiedliche Muster für drei mehr oder minder abgrenzbare Zeiträume: In der Nachkriegszeit standen sich die christdemokratische und sozialdemokratische Partei und deren soziale Milieus unversöhnlich gegenüber. Die Wahl war insofern affektgetrieben, als dass die meisten Wähler:innen einem der sozio-demografischen Milieus angehörten und es für sie instinktiv klar war, welche Partei zu ihnen gehört und welche nicht. Mit fortschreitender Auflösung dieser sozialen Milieus und der inhaltlichen Annäherung der christdemokratischen und sozialdemokratischen Parteien im Rahmen der Strategie der „Neuen Mitte“ begann eine zweite weniger affekt-geladene Periode. In dieser stritten sich die Parteien weniger über ideologische Unterschiede, sondern versuchten sich vor allem über ihre Kompetenz in der Umsetzung ähnlicher Politiken zu profilieren. Mit dem Aufkommen populistischer Parteien (in Deutschland der Linken und später der AfD) nimmt der Streit zwischen den Parteien – insbesondere zwischen den etablierten Parteien und ihren populistischen Herausforderinnen – wieder zu und die Wahlentscheidung wird wieder zunehmend von den Affekten der Bürger:innen zu unterschiedlichen Lagern getrieben. Anders als früher erklären die klassischen Milieus nicht mehr, wer sich stärker mit welchen Parteien verbunden fühlt. Der Affekt ist also zurück, scheint sich aber aus anderen Quellen zu speisen.Zum aktuellen Forschungsstand tragen wir insbesondere durch die Weiterentwicklung klassischer Theoriestränge der Parteien- und Wahlforschung in Bezug auf das Verhältnis zwischen Sozialstruktur, Affekt und Wahlentscheidung und deren systematischer, empirisch-historischer Gegenüberstellung mit Hilfe des Datenschatzes der Forschungsgruppe Wahlen bei. Aus praktischer Perspektive stellen wir fest, dass etablierte politische Ausrichtungen nicht inhärent „un-emotional“ sind. Vielmehr zeigt die Analyse, dass auch etablierte Parteien einst von affektgeladener Politik profitiert haben. Die Frage ist daher, warum letztere von emotionaleren Ansprachen an die Bürger:innen absehen und ob sie diese Strategie nicht überdenken müssen, um ihre populistischen Herausforderinnen zu stellen.
Rudolf-Wildenmann-Nachwuchspreis für empirische Wahlforschung
Mit der Benennung dieses Preises nach Prof. Rudolf Wildenmann will die Forschungsgruppe nicht nur dessen Verdienste für die Etablierung der empirisch fundierten Wahlforschung in Deutschland hervorheben, sondern auch eine Person ehren, die vielleicht weniger selbst mit eigenen wissenschaftlichen Beiträgen, wohl aber mit einem genialen Verständnis für die Notwendigkeit der Institutionalisierung von Forschung und Wissenschaft hervorgetreten ist.So konnte die Forschungsgruppe bei ihrer Gründung 1974 auf die Arbeit von Prof. Wildenmann aufbauen, auch wenn die Gründung der von der Universität Mannheim unabhängigen neuen Institution durch ehemalige Mitarbeiter von Prof. Wildenmann nicht ohne Friktionen zustande gekommen war.zum Seitenanfang
Seite zuletzt geändert am 27.03.2025 um 13:28 Uhr
zum Seitenanfang